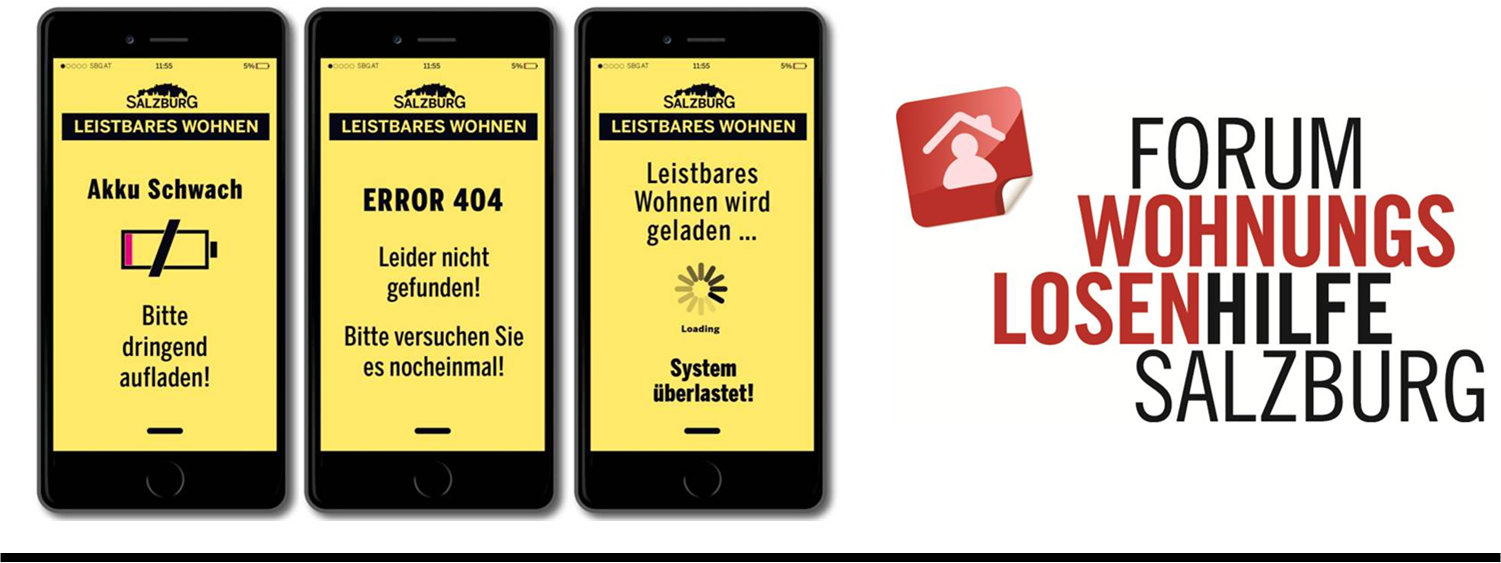Lesezeit: rund 7 Minuten
Rezension von Peter Linhuber
Ken Loach hatte nach beinahe 50-jähriger Tätigkeit als Filmschaffender – sein erster Film CATHY COME HOME stammt von 1966 – 2014 eigentlich seinen Rückzug angekündigt. Bereits zwei Jahre später schuf er mit I, DANIEL BLAKE seinen nächsten Film, der mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde. Ein Alterswerk, aber getreu Loachs Vorstellungen des “sozialen Realismus” eines ohne Altersmilde.
Loach geht gleich in medias res und beginnt unmittelbar mit dem Grundkonflikt, der auch den restlichen Film prägt: Daniel Blake (Comedian Dave Johns) spricht mit einer “Health Care Professional”, die in ihrer vermeintlichen Professionalität und Distanziertheit schon fast ein Automat sein könnte. Er darf laut seinem Arzt derzeit nicht arbeiten, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hat und dabei von einem Gerüst gestürzt ist. Der standardisierte Fragebogen (“Können Sie die Arme so über den Kopf bewegen als würden Sie einen Hut aufsetzen?”) ergibt allerdings nicht die geforderten 15 Punkte, sondern nur 12. Blake wird entsprechend als “arbeitsfähig” eingestuft und muss sich trotz seiner gesundheitlichen Probleme um eine Stelle bemühen. Einspruch ist erst möglich, wenn er einen entsprechenden Bescheid erhalten hat und sich ein ominöser “Decision Maker” bei ihm gemeldet hat. Von Anfang an ist Blake somit in einem geradezu kafkaesken System gefangen, mit undurchsichtigen bürokratischen Abläufen, deren Korrektheit über den einzelnen Schicksalen steht.
Der Tischler Blake, der nach eigener Aussage allein ein ganzes Haus errichten könnte, die notwendigen Mittel vorausgesetzt, stört das unpersönliche System zwar, indem er versucht seine Individualität und Menschlichkeit zu bewahren und nicht einfach zur Nummer zu werden, ist aber durchaus arbeitswillig. Entsprechend nimmt er den Termin auf dem Arbeitsamt wahr, wo er die alleinerziehende Mutter Katie (Hayley Squires) kennenlernt. Sie steckt in einer ähnlich misslichen Lage und lernt, nachdem sie verbal gegen eine Entscheidung aufbegehrt, in Form der Security die punitive Härte des Systems kennen. Blake beschließt sie mit seinem handwerklichen Geschick zu unterstützen – die tragende Menschlichkeit des Films, die auch als Solidarität der Arbeiter*innenklasse gelesen werden kann.
Menschliche Wärme und Solidarität auf der einen Seite, Kälte und Gehorsam auf der Anderen – in manchen Rezensionen wird I, DANIEL BLAKE ein stark vereinfachendes Schwarz-Weiß-Denken vorgeworfen. Es geht allerdings nicht darum, dass die Vertreter*innen des Systems einfach schlechte Menschen wären – auch die freundliche Mitarbeiterin des Arbeitsamts kann die Regeln nicht ändern. Vielmehr handelt es sich um eine Opposition von Menschen und einem System, das sich an einer Maschine oder einem Computer orientiert, und für das jeglicher Hauch von Individualismus entsprechend Sand im Getriebe ist und dass voraussetzt, dass alle unhinterfragt ihre Rollen spielen. Gerade Protagonist Daniel ist zugegebenermaßen schon fast ein Heiliger, der sich lieber aufopfert, als sich etwas zu Schulden kommen zu lassen. Aber ohne seine tiefe Humanität und gelegentliche Anflüge von Humor wäre Loachs Film wohl fast unerträglich und würde sich zumindest an der Grenze zu Zynismus und Misanthropie bewegen. Um einen echten dramatischen Gegenpart zum System zu schaffen, braucht es die starke Menschlichkeit.
“I, Daniel Blake”: Die Worte erinnern schon fast an den Beginn eines Testaments. Im Film beginnt so die Botschaft, die Blake schließlich unter Beifall der Passant*innen an die Wand des Arbeitsamts sprayt, sowie der Appell, den er für seinen Einspruch vorbereitet hat. Dabei kämpft er wieder gegen die Verdinglichung durch das System an, verweist wie der “Elephantine Man” von David Lynch darauf, dass er ein Mensch ist und entsprechend wie ein solcher behandelt werden will. Aus diesem Konflikt schöpft das Spätwerk von Loach seine Kraft, mit der es einerseits vor Trauer zu Tränen rührt, und einen andererseits vor Wut die Fäuste ballen lässt.